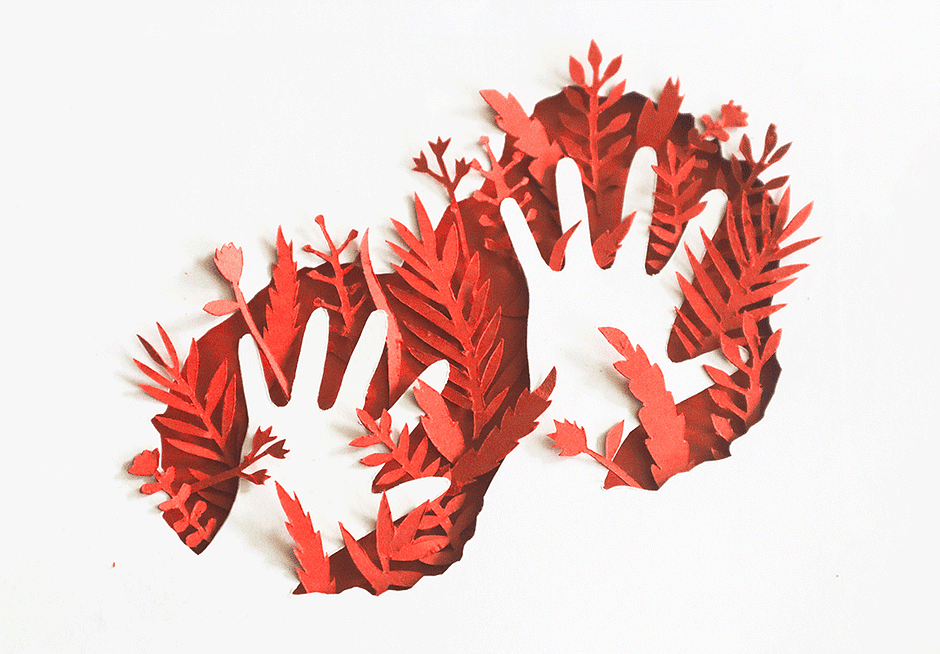Die „Entdeckung“ von Machu Picchu

2011 jährte sich die „Entdeckung“ Machu Picchus zum 100. Mal. Doch der Begriff „Entdeckung“ ist irreführend. Die Inkastätte war mit ziemlicher Sicherheit schon lange vor der Ankunft des US-amerikanischen Archäologen Hiram Bingham bekannt – so wie Südamerika schon Tausende von Jahren vor der Landung von Kolumbus von indigenen Völkern besiedelt war.
Vor 100 Jahren verließ in Peru ein Geschichtsprofessor, der an der Yale University lehrte, sein Lager in einem Tal nordwestlich von Cusco. Er lief durch den Nebelwald zu einem Berggrat, der in mehr als 2.300 Metern Höhe über dem Meeresspiegel aufragte. Dort, weit über dem darunter tosenden Urubamba-Fluss, fand er eine uralte Zitadelle aus Stein; außerdem terrassenartig in den Stein gehauene Tempel und Grabmäler, Gebäude aus Granit und glatt geschliffene Wände, die im Laufe von Jahrhunderten von Kletterpflanzen und anderer Vegetation überwuchert worden waren.

Hiram Bingham war nichtsahnend auf die Inkastätte von Machu Picchu gestoßen, die er für die sagenumwobene „Verlorene Stadt der Inka“ hielt. 1913 schrieb er in der Jahresausgabe von „National Geographic“: „Machu Picchu könnte sich als die größte und wichtigste Ruine herausstellen, die in Südamerika seit der spanischen Eroberung entdeckt wurde.“
Doch Binghams Worte waren irreführend. Denn er hatte Machu Picchu nicht „entdeckt“. Ebenso wenig war es „verloren“ gewesen. Er mag zwar die wissenschaftliche Gemeinschaft der westlichen Welt aufmerksam gemacht haben – denn in den Chroniken der spanischen Invasoren fanden sich keine Berichte über die Anlage – aber Angehörige indigener Völker, die in der Gegend lebten, müssen von der Existenz Machu Picchus gewusst haben.
Es ist eher unwahrscheinlich, dass Binghams Ausdrucksweise negative Folgen für die lokale indigene Bevölkerung hatte. Doch die Sprache der Kolonisatoren hat über lange Zeit auf tragische Weise zur Zerstörung indigener Völker auf der ganzen Welt beigetragen: Über Jahrhunderte wurden traditionelle Gebiete indigener Völker als „unbewohnt“ bezeichnet, um den Diebstahl ihres Landes zu rechtfertigen – sei es aus militärischen oder wirtschaftlichen Gründen oder im Namen des Naturschutzes. Schließlich, so die Argumentation zum eigenen Vorteil: Wo niemand lebt, da müssen selbstverständlich auch keine Menschenrechte geachtet werden.
Auf ganz ähnliche Art haben rassistische Vorurteile – konzentriert in Bezeichnungen indigener Völker als „rückständig“, „unzivilisiert“ und „wild“ – vielerorts zu Geringschätzung und Furcht gegenüber indigenen Völkern beigetragen. Diese Einstellung wiederum untermauert die erschreckende Behandlung, der indigene Völker unterworfen werden. In den Augen der Täter ist sie oft sogar eine Rechtfertigung.
Als europäische Siedler an den Küsten Australiens landeten, erklärten sie das Land zu „terra nullius“ – Land, das niemanden gehöre. Doch die Aboriginal-Völker hatten dort schon seit wahrscheinlich 50.000 Jahren gelebt. Das Konzept von „terra nullius“ wurde dennoch offiziell erst 1992 zu Fall gebracht. Es hatte es ermöglicht, jenen Menschen ihr Land auf „legitime“ Weise zu stehlen, die den Kontinent als erste besiedelt hatten.
Aborigines besaßen unter der Herrschaft des britischen Kolonialrechts keinerlei Rechte. Man hielt sie für zu primitiv, um überhaupt Eigentümer von etwas sein zu können. Innerhalb von kaum mehr als hundert Jahren seit der ersten Invasion durch Siedler, wurde die Aboriginal-Bevölkerung in Australien von einer geschätzten Millionen auf nur noch 60.000 Angehörige dezimiert.
Ganz ähnlich war es im Fall von Christopher Kolumbus, den die Winde des Handels 1492 in die „Neue Welt“ wehten: Es handelte sich nicht etwa um eine „Entdeckung“, sondern er landete in den Heimat von Völkern, die bereits seit Jahrtausenden dort gelebt hatten. Gemeinschaften, die ihre eigenen bewährten Gesetze, Religionen, Rituale, Glaubensvorstellungen, Werte und Lebensweisen hatten.

Die Yanomami beispielsweise leben seit schätzungsweise 15.000 Jahren in den Regenwäldern, die heute zu Brasilien und Venezuela gehören. „Die Weißen schreien heute: Wir haben das Land entdeckt, das heute Brasilien ist.“, erklärt Davi Kopenawa, ein Sprecher der Yanomami. „Als ob das Land unbewohnt gewesen wäre! Als ob hier nicht seit dem Beginn der Zeit Menschen gelebt hätten!“. Ein Gedanke, der sich bei Megaron Txukarramae von den Kayapo-Indianern so anhört: „Das Land, das die Weißen Brasilien nannten, gehörte den Indigenen. Ihr seid hier eingefallen und habt es in Besitz genommen.“
In Wirklichkeit waren weder Nord- noch Südamerika „neu”, Australien war vor der Ankunft der Europäer nicht „unbewohnt“ und genauso wenig wurde Machu Picchu 1911 „entdeckt“. Der Linguist und Philosoph Noam Chomsky schrieb: „Die Redewendung von der „Entdeckung“ Amerikas ist ganz offensichtlich falsch. Was da entdeckt wurde, war ein Amerika, das bereits Tausende von Jahren vorher von den Einwohnern dort entdeckt worden war. Folglich handelte es sich um eine Invasion Amerikas – eine Invasion durch eine sehr fremdartige Kultur.“
Diese Länder waren die Heimat indigener Völker. Und sie sind es noch immer. Die Behauptung, ein Land sei vor dem Eindringen der Kolonisatoren „unbewohnt“ gewesen und erst „entdeckt“ worden, bedeutet, den indigenen Völkern ihre Identität zu rauben, ihre Würde und ihre Landrechte. Es bedeutet, ihre blanke Existenz zu verleugnen. Oder in den Worten von Marcos Veron vom Volk der Guarani-Kaiowa in Brasilien: „Wenn du mir dieses Land nimmst, nimmst du mir mein Leben.“