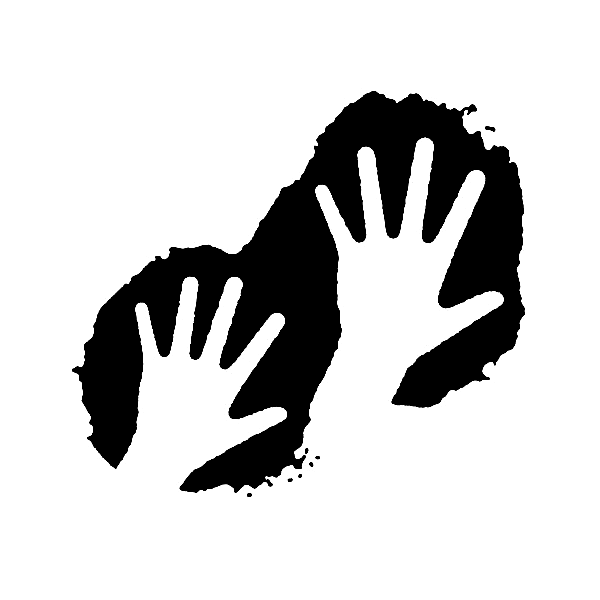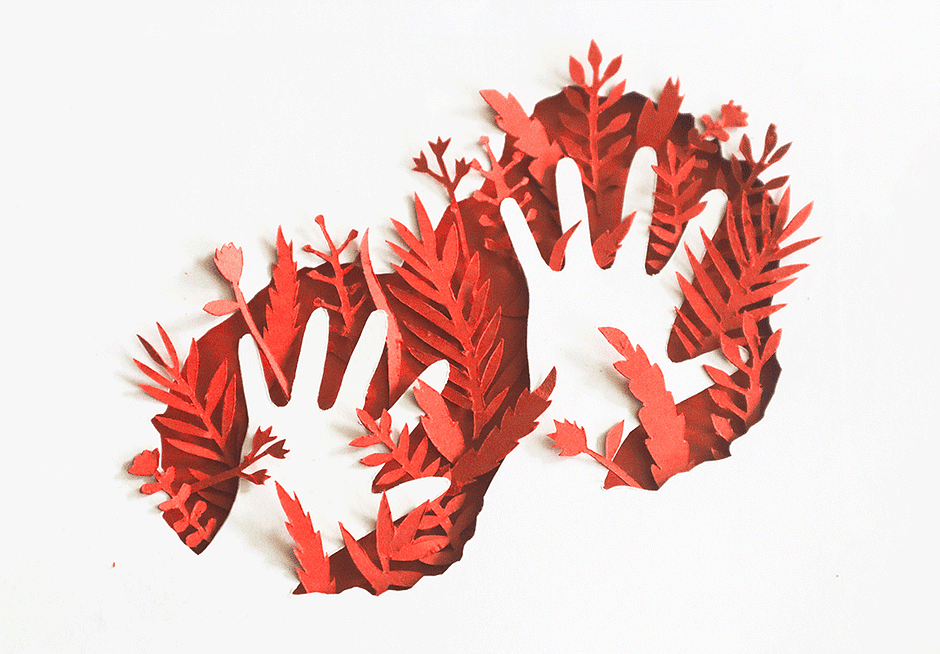Fortschritt oder Fassade? Wie die Naturschutzindustrie den Artenschutz kapert

31 Jahre nach Inkrafttreten des Übereinkommens über die biologische Vielfalt (CBD) findet erneut eine Konferenz der Vertragsparteien (COP16) statt – das regelmäßige Treffen von Regierungen, Nichtregierungsorganisationen und anderen Akteur*innen, die an diesem Abkommen beteiligt sind.
Diese COP ist besonders bedeutsam, da sie zentrale, aber bislang ungelöste Fragen im Zusammenhang mit dem Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework klären soll – dem neuen globalen „Aktionsplan“ für den Schutz der biologischen Vielfalt.
Lass dich vom trockenen Titel nicht täuschen: Was hier entschieden wird, hat weitreichende Konsequenzen für Millionen Menschen weltweit – insbesondere für indigene Völker. Denn dieser Aktionsplan weist schwerwiegende Mängel auf.
Anstatt eine wirklich transformative Initiative voranzutreiben, setzt der Rahmenplan auf dieselben überholten Strategien wie bisher: ein von Regierungen und internationalen Organisationen gesteuertes, koloniales Top-down-Modell des Artenschutzes, das tief in rassistischen Strukturen verwurzelt ist. Obwohl es seit Langem als gescheitert gilt, wird weiterhin daran festgehalten.
Ein bezeichnendes Beispiel dafür, wie die Verhandlungen von Beginn an auf dieses Modell hinausliefen, war die Entscheidung, die Umsetzung des neuen Biodiversitäts-Aktionsplans nicht über einen unabhängigen globalen Fonds zu finanzieren – wie es viele Länder des Globalen Südens gefordert hatten. Stattdessen wurde das Geld unter die Kontrolle der Global Environment Facility (GEF) gestellt, einer langjährigen Kooperation zwischen der Weltbank, verschiedenen UN-Organisationen und Regierungen.
Diese Wahl ist höchst problematisch: Die GEF verlangt nicht die Einhaltung des Rechtes indigener Völker, ihre freie, vorherige und informierte Zustimmung (Free, Prior and Informed Consent, FPIC) zu Projekten zu geben, die ihr Leben, ihr Land und ihre Rechte betreffen.
Der neue Fonds – der Global Biodiversity Framework Fund (GBFF) – ist direkt an die GEF gekoppelt und übernimmt deren problematische Strukturen. Nur sogenannte „GEF-Agenturen“ können Mittel für neue Artenschutzprojekte beantragen. Unter diesen 18 Institutionen befinden sich multinationale Entwicklungsbanken und große Naturschutzorganisationen wie WWF und Conservation International, die seit Jahren mit Menschenrechtsverletzungen in Naturschutzprojekten in Verbindung gebracht werden.
Dem Geld auf der Spur
Survival International hat im Herbst 2024 alle 22 bis dahin genehmigten Projekte des GBFF analysiert – mit alarmierenden Ergebnissen:
- Nur eines dieser Projekte richtet sich explizit an indigene Völker.
- Die an die Antragssteller ausgezahlten „Gebühren“ – d. h. über die tatsächlichen Kosten der Projekttätigkeit hinaus – belaufen sich auf 24 % der insgesamt verfügbaren Mittel. Der tatsächliche Anteil, der bei diesen Agenturen verbleibt, dürfte noch höher sein.
- Der WWF USA war am erfolgreichsten bei der Antragsstellung: Fünf seiner Projekte erhielten zusammen 36 Millionen Dollar – fast ein Drittel der bislang bewilligten Gelder.
- Das UN-Entwicklungsprogramm (UNDP) und Conservation International (CI) erhalten jeweils etwa ein Viertel der Gesamtmittel. Zusammen mit der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der UN (FAO) kontrollieren sie 85 % der ersten 110 Millionen Dollar an Finanzmitteln.
- Eines der Projekte finanziert – über den WWF – Schutzgebiete in Afrika, die seit Jahren für die brutale Vertreibung indigener Völker und Gewalt durch Wildhüter*innen bekannt sind.
- Ein erheblicher Teil der Mittel fließt in das „30×30“-Ziel, das vorsieht, bis 2030 30 % der weltweiten Land- und Meeresflächen unter Schutz zu stellen. Dies ist besonders alarmierend, da Nationalparks, Wildtierreservate und andere Schutzgebiete schon jetzt eine der größten Bedrohungen für indigene Völker darstellen.
- Immer wieder gingen solche Naturschutzmaßnahmen mit gewaltsamen Vertreibungen, Ausgrenzung und der Zerstörung indigener Lebensgrundlagen einher. Diese Praktiken setzen sich bis heute fort – ein Beispiel ist die erzwungene Umsiedlung Tausender Maasai aus dem Ngorongoro-Schutzgebiet in Tansania.
Survival International hält dieses Finanzierungsmodell für grundsätzlich verfehlt. Es fördert eine Fortsetzung der gescheiterten, kolonial geprägten Naturschutzpolitik anstatt eines dringend benötigten, menschenrechtebasierten Ansatzes. Indigene Völker haben kaum Zugang zu diesen Geldern, obwohl sie nachweislich die besten Hüter*innen der biologischen Vielfalt sind.
Der gesamte Finanzierungsmechanismus muss überdacht werden. Mittel sollten vorrangig an indigene Völker und lokale Initiativen gehen, anstatt in die Taschen großer Naturschutzorganisationen zu fließen. Zudem muss jede Finanzierung für neue oder erweiterte „Festungsnaturschutz“-Projekte gestoppt werden.
Die Schätzungen zu den gigantischen Summen, die angeblich für den Schutz der Biodiversität benötigt werden – oft wird von 700 Milliarden Dollar jährlich gesprochen – stammen von Organisationen, die selbst ein Interesse daran haben, das diese Summen möglichst hoch ausfallen. In Wahrheit wären weit weniger Mittel erforderlich, wenn die Rechte indigener Völker umfassend anerkannt würden, anstatt auf teure, militarisierte und von oben gesteuerte Naturschutzmodelle zu setzen.
Biodiversitätszertifikate: eine neue Bedrohung
Das Konzept der Biodiversitätszertifikate funktioniert ähnlich wie der Markt für CO₂ -Zertifikate: Unternehmen und Organisationen können ihre umweltzerstörenden Aktivitäten angeblich „ausgleichen“, indem sie Gutschriften von Projekten erwerben, die Emissionen reduzieren, verhindern oder CO₂ aus der Atmosphäre entfernen sollen. In der Praxis ist dieses System jedoch voller Probleme. Es hängt der Natur ein Preisschild an und behandelt die angestammten Gebiete indigener Völker als handelbare Kohlenstoff- oder Biodiversitätsreserven – also als Waren. Während Umweltsünder*innen weiterhin ungehindert agieren, profitieren große Naturschutzorganisationen von ihren Milliardensummen. Indigene Völker hingegen verlieren ihr Land und ihre Lebensgrundlage.
Wie die Kohlenstoffmärkte sind auch Biodiversitätszertifikate Teil eines neuen Vorstoßes zur Kommerzialisierung der Natur. In einer aktuellen Erklärung fordern über 250 Umwelt-, Menschenrechts-, Entwicklungs- und Gemeindeorganisationen – darunter Survival International – einen sofortigen Stopp dieser Programme.
Neben den technischen, moralischen und philosophischen Bedenken, die mit der Bepreisung und In-Wert-Setzung von Arten oder ganzen Ökosystemen einhergehen, birgt dieses Konzept eine gravierende Gefahr für indigene Völker. Sie wären einem noch stärkeren Druck durch Landraub ausgesetzt, da Projekte zu Generierung von Biodiversitätszertifikaten gezielt biologisch vielfältige Gebiete ins Visier nehmen, in denen indigene Völker leben und die sie seit Generationen verwalten. Die „Naturschutzleistungen“, die indigene Völker über Generationen erbracht haben, werden ihnen damit zum Verhängnis und machen ihre Gebiete zu Zielen der globalen Naturschutzindustrie.
Gibt es dennoch Hoffnung für diese COP? Die ehrliche Antwort lautet: kaum. Der Prozess des Biodiversitätsschutzes wurde von denselben Institutionen vereinnahmt, die seit Jahrzehnten auf Kosten indigener Völker profitieren – obwohl genau diese Gemeinschaften die wichtigsten Hüter*innen der Natur sind.
Das Mindeste, was erreicht werden muss, ist die uneingeschränkte Achtung des Rechts indigener Völker auf freie, vorherige und informierte Zustimmung (FPIC). Indigene Organisationen und ihre Verbündeten werden alles daransetzen, dies sicherzustellen.
Die eigentliche Lösung für den Schutz der biologischen Vielfalt ist längst bekannt: Die Landrechte indigener Völker müssen respektiert werden, und die wahren Ursachen der Umweltzerstörung – nämlich die rücksichtslose Ausbeutung natürlicher Ressourcen zur Profitmaximierung – müssen bekämpft werden.
Wie erfrischend wäre es, wenn dies ganz oben auf der COP-Agenda stehen würde.
Von Fiore Longo, Expertin und Aktivistin bei Survival International. Sie koordiniert auch Survivals Kampagne Decolonize Conservation. Sie hat viele indigene Völker in Afrika und Asien besucht, die im Namen des Naturschutzes von schrecklichen Menschenrechtsverletzungen betroffen sind.
Ursprünglich veröffentlicht in African Arguments, Oktober 2024.