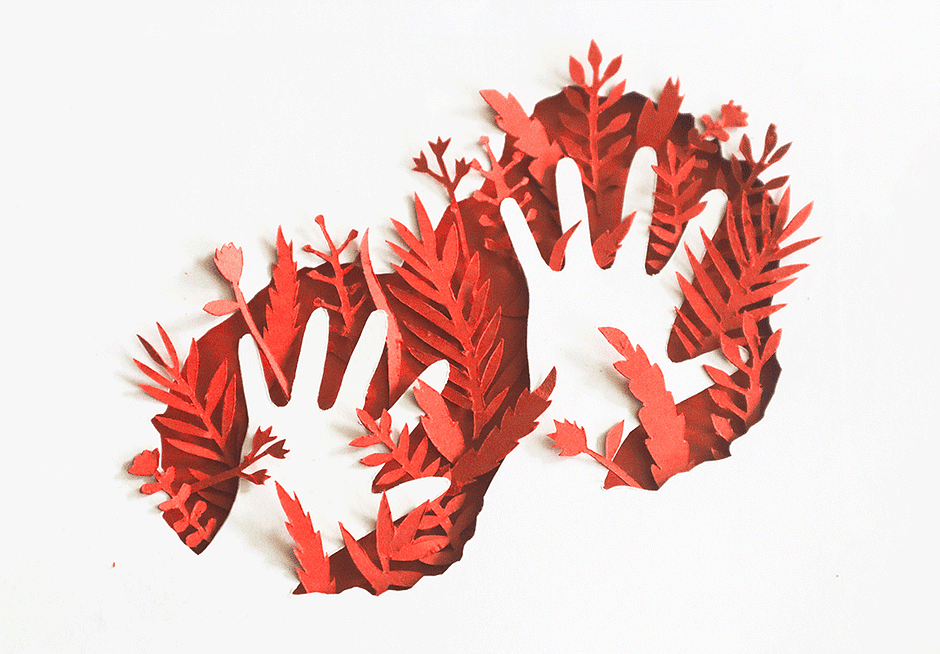Der Selbstmord der Guarani – Wie die Trennung zwischen Mensch und Natur die Psyche beeinflussen kann

„Viele Kinder leiden“, erzählt uns Dilma Modeste, eine Guarani-Gesundheitsbeauftragte aus Brasilien. „Ich möchte, dass die Kinder wieder so werden wie zuvor, als noch alles in Ordnung war.“
„Zuvor“ war, als die Guarani frei auf ihrem Land jagten und Maniok und Mais in ihren Gärten anpflanzten. Es war, bevor sie aus ihren Wäldern vertrieben wurden und diese in riesige Gebiete für Viehzucht, Sojaanbau und in Zuckerrohrplantagen verwandelt wurden. „Zuvor“ war, als die Guarani noch Stolz empfanden und die Kontrolle über ihr Leben hatten und nicht wie heute unter Plastikfetzen auf staubigen Straßen leben und verschmutztes Wasser aus Plastikdosen trinken müssen.
„Zuvor“ und „alles in Ordnung“ war lange bevor Guarani-Kinder anfingen, Selbstmord zu begehen. In den letzten dreißig Jahren haben sich mehr als 625 Guarani-Indigene das Leben genommen. Ihre Selbstmordrate ist damit 19-mal höher als die des brasilianischen Durchschnitts. Junge Erwachsene unter 30 Jahren machen 85 % dieser Suizide aus. Und noch schlimmer: Das jüngste Opfer war erst 9 Jahre alt.
Der Verlust und die Zerstörung ihres Landes sind die Wurzeln dieses entsetzlichen Leidens. Denn für die Guarani bedeutet – wie für die meisten indigenen Völker – ihr Land alles. Es ernährt und schützt sie; es prägt ihre Sprachen, ihre Vorstellungen von der Welt und ihre Identität. Es ist auch die Begräbnisstätte ihrer Vorfahren und das Erbe ihrer Kinder. Land ist genau das, was sie sind. Die Grenze zwischen der natürlichen Welt um sie herum und ihrer inneren Welt ist im Grunde genommen sehr dünn.
In der Vergangenheit erstreckte sich das Land der Guarani über eine Wald- und Flachlandfläche von 350.000 km². Heute leben sie zusammengepfercht auf winzigen Landstrichen. „Die Guarani begehen Selbstmord, weil sie kein Land mehr haben“, bedauert eine Guarani-Frau. „Zuvor waren wir frei. Jetzt sind wir es nicht mehr. Nun sehen sich unsere Jugendlichen um, erkennen, dass wir nichts mehr haben, fangen an nachzudenken, verlieren sich und begehen schließlich Selbstmord.“
In den letzten Jahren wurde viel über die verheerenden Auswirkungen dieser Trennung von der natürlichen Welt auf die menschliche Psyche geschrieben. Der verstorbene Philosoph Paul Shepard, ein brillanter Pionier der Ökologie und Autor von „Nature and Madness“, war überzeugt, dass die ökologische Zerstörung einen tiefgreifenden Einfluss auf unsere psychische Stabilität als Spezies hatte. In seinem Buch „Das letzte Kind im Wald“ zögert der Journalist Richard Louv nicht über Störungen bei Kindern zu sprechen, denen der Kontakt mit der Natur vorenthalten wurde.
 © João Ripper/Survival
© João Ripper/Survival
Indigene Völker sind vielleicht am besten in der Lage, die negativen Auswirkungen dieser Trennung von der natürlichen Welt zu verstehen. Typischerweise wurde die Identität eines indigenen Volkes über Generationen hinweg in einer symbiotischen Beziehung zu seiner unmittelbaren Umgebung aufgebaut. Wenn sie gezwungen sind, ihr Land zu verlassen, ist die Veränderung oft zu plötzlich, um sich an die neue Situation anzupassen und um sie zu ertragen. „Wenn du der Natur nahe bist, wenn du von Wäldern umgeben bist, dann hast du das Leben, dann hast du alles“, erzählt ein Angehöriger der Guarani. Die erzwungene Umsiedlung bedeutet, dass „alles“ zu „nichts“ wird – eine Perspektive, die viele indigene Völker erlebt haben, und der viele andere immer noch begegnen. Dieser Ausblick führt oft zu geistiger und spiritueller Verwüstung. „Du wirst folglich geistig leer“, führt er fort.
In Kanada ist die Selbstmordrate unter den Innu ebenso hoch. Vor nur 50 Jahren waren die Innu noch Nomad*innen. Sie wanderten saisonal durch das Weidengebüsch und den Fichtenwald von Nitassinan, ihrer Heimat in der Arktis, und jagten Karibus, Elche und Kleinwild. Dieses nördliche Gebiet mit labyrinthischen Wäldern und gewundenen Flüssen war 7.500 Jahre lang ihr Land. Es hat ihre Geschichte, Fähigkeiten, Kosmologie und Sprache geprägt und hat ihre Einzigartigkeit als menschliche Gesellschaft gestärkt. „Das Land ist Teil deines Lebens“, sagt George Rich, ein Innu. „Alles, was mit Land verbunden ist, symbolisiert die Innu-Identität – wer du als Mensch bist.“
In den 1950er und 1960er Jahren zwangen die kanadische Regierung und die katholische Kirche – im Glauben, sie wüssten besser als die Innu, wie diese leben sollten – das indigene Volk dazu, sich in festen Gemeinden niederzulassen. In ihrer bloßen Existenz als blasse Nachbildungen des europäischen Lebens, das sie nicht verstanden und nicht wollten (die kanadische Regierung wollte, dass sie „wie alle anderen Kanadier*innen“ werden), in ein Niemandsland kultureller Verwirrung und existenzieller Verzweiflung gestürzt, wurden die Innu schnell deprimiert. Das Einatmen von Benzin wurde bei Kindern zur Gewohnheit. Jäger*innen, denen Bewegung, Freiheit, Sinn und Zweck geraubt worden waren, wurden abgewertet und zu Alkoholiker*innen. „Früher, als die Sozialdienste einen Innu nach seiner Beschäftigung fragten, antwortete er noch: ‚Jäger‘. Jetzt antwortet er ‚arbeitslos‘“, klagt Jean-Pierre Ashini, ein Innu.
Die Depression wurde durch die radikale Veränderung von einer natürlichen Ernährung mit reichhaltigem Fischöl zu einer mit Zucker beladenen Ernährung sowie einer Abnahme der körperlichen Bewegung verschlimmert. „Die plötzliche Veränderung von einer Diät basierend auf Jagd, Fischfang und Sammeln zu im westlichen Supermarkt gekauften Lebensmitteln ist ein bedeutender Risikofaktor für die Verschlechterung der psychischen Gesundheit der zirkumpolaren Völker“, sagte der Anthropologe Colin Samson, der mehrere Jahrzehnte mit den Innu zusammenarbeitete.
Das Verschwinden ihrer angestammten Lebensweise verschärft unter indigenen Völkern häufig physische Gesundheitsprobleme und schwächt die Pfeiler für eine gute psychische Gesundheit. Das Selbstwertgefühl, der Zweck, der Sinn, das Bedürfnis nach Hoffnung und der Erhalt menschlicher Freundlichkeit brachen unter der fauchenden Verachtung der Regierung für ihre traditionellen Lebensweisen zusammen. Der amerikanische Psychologe Abraham Maslow war überzeugt, dass der Mensch eine „Hierarchie der Bedürfnisse“ hat, ohne die er nicht normal funktionieren könne. Nahrung, Luft und Wasser sind unbestreitbar essenziell für alles Leben. Sicherheit, Selbstwertgefühl, Respekt, Liebe und Zugehörigkeit stehen jedoch nicht weit hinter diesen physiologischen Grundbedürfnissen und sind für die Erfüllung jedes Menschen unerlässlich. Als die Regierung die Lebensweise der Innu als „rückständig“ abwertete, als ihr religiöser Glaube von der Kirche als Teufelsanbetung verspottet wurde und ihre Ideen und Meinungen als minderwertig abgetan wurden, fingen sie an, dies zu glauben. Der bereits gebrochene Innu-Geist wurde weiter geschwächt. „Wenn dir gesagt wird, dass deine Lebensweise wertlos ist, was kannst du dann tun?“, fragt ein Innu.
Leider sind die Guarani und die Innu in diesem Fall nicht alleine. Seit Jahrhunderten wurde die psychische Gesundheit vieler indigenen Gruppen von Angreifern vernichtet, die nicht ertragen konnten (oder wollten, weil Rassismus und kulturelle Leugnung seit der Kolonialzeit nützliche Werkzeuge waren, um Länder und Ressourcen zu beschlagnahmen), dass „Menschen, die anders als sie selbst leben, möglicherweise immer noch auf dem aufsteigenden und progressiven Weg des Lebens voranschreiten“, erklärt der Ponca-Anführer Standing Bear.
In seinem Buch „Tribal Peoples for Tomorrow’s World“ argumentiert Stephen Corry, der Direktor von Survival International, dass indigene Völker andere Entscheidungen getroffen hätten als die meisten industrialisierten Gesellschaften: „Mobil anstatt sesshaft zu sein, Jäger*in oder Hirt*in und nicht Landwirt*in zu sein oder keinen Wohlstand anzuhäufen“ mache indigene Völker jedoch nicht „rückständiger als alle anderen“. Es ist nur die Eitelkeit einer Gesellschaft, sich selbst aufgrund ihres materiellen Reichtums oder ihres technologischen Fortschritts als progressiver oder „zivilisierter“ zu betrachten. Es ist eine Illusion. „Du hast deinen Weg, sagte Nietzsche … und ich habe meinen. Den guten Weg, den richtigen Weg und den einzigen Weg gibt es nicht.“
Für indigene Gemeinden gibt es keine stabile psychische Gesundheit ohne Land und die Fähigkeit, die eigene Zukunft zu kontrollieren. Die Antwort auf ihre Verzweiflung liegt also in relativ einfachen Lösungen: Land und Selbstbestimmung. Statistiken zeigen, dass diese Menschen, wenn sie eigenständig auf ihrem Land leben, gesünder sind als diejenigen, die entwurzelt wurden und denen „Fortschritt“ aufgezwungen wurde. „Wenn sie ihr Land voll nutzen können, sind die meisten indigenen Völker nicht besonders anfällig“, schreibt Stephen Corry. „Sie können genauso gut überleben und sich an neue Umstände anpassen wie jede*r von uns.“
Der Film „Birdwatchers – Das Land der roten Menschen“ porträtiert auf sehr bewegende Weise den Prozess der territorialen Enteignung der Guarani. Als ihr Anführer von einem aggressiven Kolonisten der dritten Generation, der das Ahnenland für sich beansprucht, angegriffen wird, beugt er sich vor, nimmt eine Handvoll rote Erde und beginnt sie zu essen. Mit einer einfachen Geste zeigt er, dass sein Land und seine Gemeinde untrennbar sind.
„Wir Indigenen sind wie Pflanzen“, sagte Marta Guarani. „Wie können wir ohne unser Land leben, ohne unseren Boden?“